Zwischen Kittsee und Kalch wurden 1998 nur 1.213 Ehen geschlossen und 2.231 Kinder geboren. Damit lag das Burgenland voll im Trend, da in ganz Österreich die Heirats- und Geburtszahlen abnahmen. Die Bevölkerungsanzahl im Burgenland blieb zwischen 1945 und 1990 relativ konstant, da die relativ starke Abwanderung durch die Geburtenüberschüsse, bis zum Jahr 1963 zählte man im Burgenland jedes Jahr über 5.000 Geburten, kompensiert wurde. Danach nahmen die Zahlen jedoch ab und 1975 gab es Geburtendefizite, die jedoch ab den 1990er Jahren durch verstärkte Zuwanderung ausgeglichen wurden. Das Wanderungsplus wurde auf Grund der Ostöffnung und der besseren Infrastruktur vor allem im Nordburgenland erzielt. Wurden in den 1950er Jahren noch rund 2.000 Ehen im Jahr geschlossen, so waren es in den 1960er und 1970er Jahren nur mehr 1.700. Heiraten wurde immer mehr „out“ und neue Formen des Zusammenlebens wurden von der Bevölkerung gepflegt. Die BF stellte im April 1999 die Frage, warum immer weniger geheiratet werde und immer weniger Kinder geboren würden.
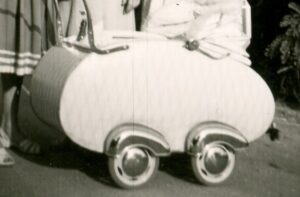 Herr S. aus Kalkgruben meinte dazu: „Ich bin nicht verheiratet, habe eine Tochter, die 15 Monate alt ist. Ich habe der Mutter meines Kindes zwar einen Antrag gemacht, sie hat ihn aber nicht angenommen, weil sie ihre Unabhängigkeit nicht verlieren wollte. Meiner Meinung nach braucht ein Kind geordnete Verhältnisse, und da gehört die Ehe dazu. Ein Kind ist für viele Menschen mit Geld verbunden und viele sind nicht bereit ohne finanzielle Absicherung ein Kind in die Welt zu setzen …“
Herr S. aus Kalkgruben meinte dazu: „Ich bin nicht verheiratet, habe eine Tochter, die 15 Monate alt ist. Ich habe der Mutter meines Kindes zwar einen Antrag gemacht, sie hat ihn aber nicht angenommen, weil sie ihre Unabhängigkeit nicht verlieren wollte. Meiner Meinung nach braucht ein Kind geordnete Verhältnisse, und da gehört die Ehe dazu. Ein Kind ist für viele Menschen mit Geld verbunden und viele sind nicht bereit ohne finanzielle Absicherung ein Kind in die Welt zu setzen …“
Frau H. aus Mönchmeierhof war der Ansicht: „Ich denke, daß für die Frauen Heiraten und Kinderkriegen immer unattraktiver wird. Wenn sie heiraten, müssen Frauen in der Regel den Namen aufgeben, und falls ein Kind kommt, den Beruf, den sie sich mühsam erworben haben. Dabei sind im Burgenland Frauenarbeitsplätze rar, und die Großmutter, die aufs Kind aufpaßt, gibt es kaum mehr. Auswege sehe ich in partnerschaftlicheren Lösungen, Kindergärten am Arbeitsplatz …“
(BF vom 7. April 1999. S. 3)
Die Geburtenzahlen haben sich heute nach der Talfahrt auf einem niedrigen Niveau von etwa 2.200 Geburten pro Jahr stabilisiert. Die Eheschließungen habe sich in den letzten fünf Jahren wieder erhöht und 2018 ließen sich über 1.400 Ehepartner trauen. Die Zuwanderung ins Nordburgenland verstärkte sich noch, sodass man um 2030 wieder über 300.000 Einwohner im Burgenland zählen wird – eine Einwohnerzahl, die auch etwa 1934 vermerkt wurde. (Statistik Burgenland)


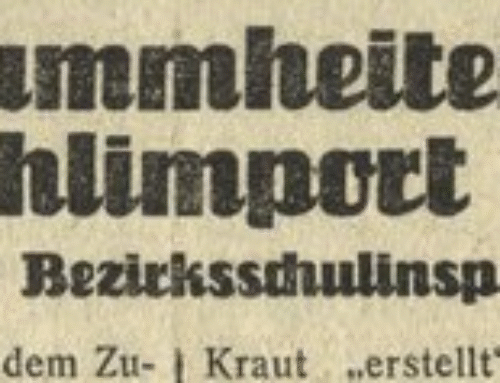

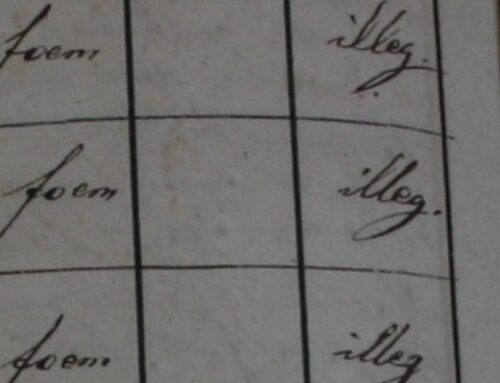
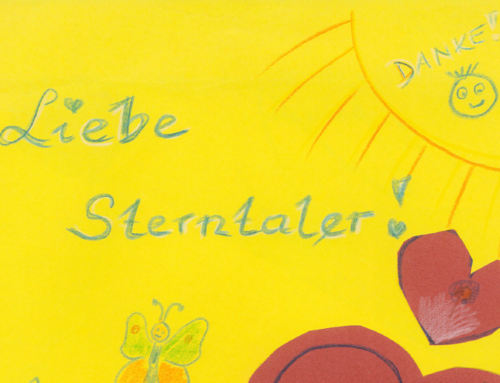
Kinder und Familie – nach wie vor Frauensache?
Der Artikel lässt durchblicken, dass das Problem der Eheschließung und Familiengründung darin verortet ist, dass man als Frau damit seine Unabhängigkeit verlieren würde. Die Eheschließungen und Geburtenrate scheinen sich wieder stabilisiert zu haben, ist aber auch die Mutterschaft attraktiver geworden?
Nach wie vor scheint es so zu sein, dass die Kindererziehung Aufgabe der Mutter bleibt. Obwohl es Konzepte wie die Karenz auch für Väter gibt, wird jene in Österreich wenig in Anspruch genommen. Diese Entwicklung ist aber auch vorhersehbar, wenn man den Gender Pay Gap beachtet.
Aber auch nach der Karenzzeit wird den Frauen oft ein Stein in den Weg gelegt:
Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind nicht ausreichend verfügbar, mögliche Großeltern sind selbst noch berufstätig und somit bleibt diese Aufgabe der Mutter über. Viele Frauen steigen dann wieder Teilzeit in den Arbeitsmarkt ein, natürlich aber nur wenn der Beruf es möglich macht und mit den Betreuungszeiten vereinbar ist.
Ein weiterer Aspekt ist die Sicht der Gesellschaft auf Mütter: während ein Vater als Held gefeiert wird, weil er sich mit den eignen Kindern beschäftigt, werden Mütter genau beobachtet und analysiert und es dürfen ihnen keine Fehler unterlaufen. Sie dürfen sich aber auch nicht zu gut um ihre Kinder kümmern, sonst gelten sie als „Helicoptermums“.
Meiner Meinung nach lassen diese Rahmenbedingungen an Attraktivität zu wünschen übrig. Umso bemerkenswerter finde ich es, wenn sich Frauen trotzdem dafür entscheiden. Genauso verständlich ist es mir, wenn man sich aus diesen Gründen dagegen entscheidet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rahmenbedingungen einer Familiengründung nach wie vor verbesserungsbedarf haben. Einerseits um den Müttern mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen, andererseits um den Vätern mehr Teilhabe am Familienleben einzuräumen.