Das milde Klima und die Bahnanbindung zur Belieferung der Wiener Märkte führten im 19. Jahrhundert dazu, dass zahlreiche Kleinbauern im Raum Wiesen sich dem Obst- und Gemüseanbau widmeten. 1862 beschrieb der Pädagoge und Journalist Moritz Alois Becker die Obstfrauen in Wiesen folgendermaßen:
 „Die Wiesner Obstweiber. Die Gegend um Forchtenau und Wiesen ist der Obstgarten des Heanzenlandes. Von der Schönheit des Oedenburger Obstes brauche ich nicht zu reden.
„Die Wiesner Obstweiber. Die Gegend um Forchtenau und Wiesen ist der Obstgarten des Heanzenlandes. Von der Schönheit des Oedenburger Obstes brauche ich nicht zu reden.
Im Dorfe Wiesen ist es von altersher überkommene Aufgab der Weiber, so lang sie rüstig sind, das Obst im Kleinhandel in die Ferne zu tragen. Wiesen ist sozusagen der Stapelplatz des Obstes. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man die Masse der Kirschen, die von hier aus vertragen werden, auf 2.000 bis 3.000 Butten, der Äpfel auf 50.000 bis 60.000 Metzen ansetzt, nicht der heanzischen Edelkastanien zu gedenken, die auf dem Wiener Markte gewiss vier Fünftel der sogenannten echten Maroni ausmachen. An der Leopoldstädter Seite der Ferdinandsbrücke haben die Wiesnerinnen ihren Standplatz; und fragt man die rotwangige Dirne, woher sie sei, so erhält man die charakteristische Antwort:,Von der Wiesn sama, und so sama, dass ma san’. In den Wiener Hauswirtschaften kennt man sie, und die Hausfrauen – nämlich jene, die sich mit der Wirtschaft befassen – wissen genau den Zeitpunkt im Kalender, wann die Wiesnerin mit ihren ‚Maschanskeräpfeln‘ kommt.“

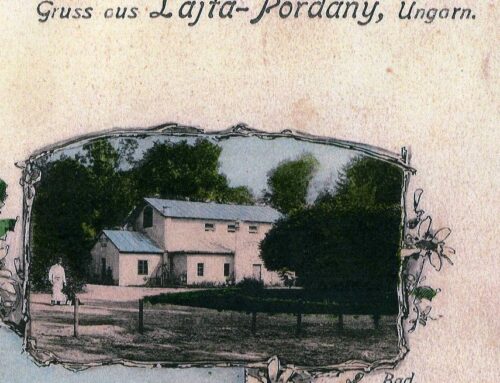




Hinterlasse einen Kommentar